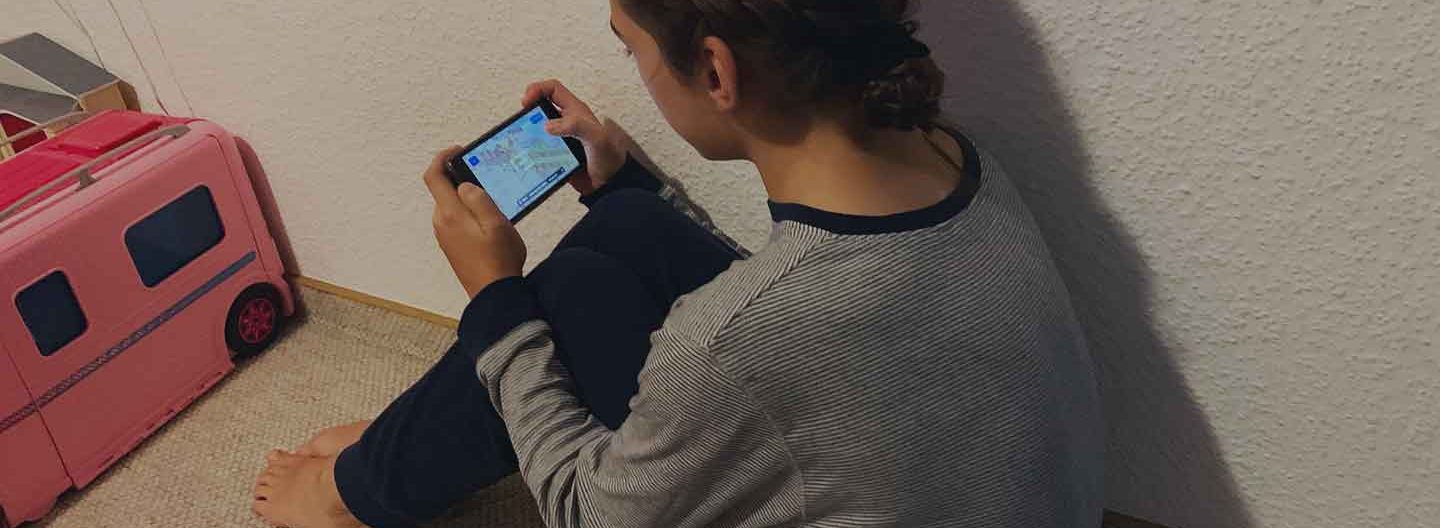Dieser Beitrag wird in Kürze aktualisiert. Solange möchten wir Sie darauf hinweisen, dass einzelne Informationen in diesem Artikel veraltet sein könnten.
Sie mussten feststellen, dass Ihr minderjähriges Kind Einkäufe über das Internet getätigt oder sogar ohne Ihr Wissen Ihre Zahlungsinformationen genutzt hat? Nun fragen Sie sich, ob der Vertrag wirksam ist und ob Sie das bereits eingezogene Geld von dem Online-Dienstleister zurückverlangen können?
Immer häufiger nehmen auch Kinder am Warenhandel teil. Gerade über das Internet werden über Portale wie ebay.de oder amazon.de (inkl. Prime Video, Fire TV und Tablets) immer mehr Verträge mit zumindest einem Vertragspartner abgeschlossen, der noch minderjährig ist. Dies gilt umso mehr, als Kinder und Jugendliche über eine erhebliche „Kaufkraft“ verfügen und insoweit eine für die Industrie nicht zu unterschätzende Zielgruppe darstellen.
In der Praxis kommt es häufig vor, dass gerade im Wege des Fernabsatzes und insbesondere über das Internet speziell für Jugendliche entwickelte Angebote vertrieben werden. So gibt es eine Vielzahl von Computerspielen und Apps, die vermeintlich kostenlos über kostenpflichtige Extrainhalte verfügen und so den Minderjährigen zum Vertragsabschluss verleiten (sog. „In-Game-Käufe“). Derartige Verträge kommen in der Regel nicht wirksam zustande, wenn sie nicht durch den § 110 BGB (sog. Taschengeldparagraf) gedeckt sind.
Vertrag mit dem Kind ist schwebend unwirksam
Die Wirksamkeit eines Vertrages hängt grundsätzlich von der Geschäftsfähigkeit der Vertragspartner ab. Minderjährige sind nach deutschem Recht nicht unbeschränkt geschäftsfähig. Als minderjährig gilt, wer das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Das Bürgerliche Gesetzbuch unterscheidet bei Minderjährigen, zwischen solchen, die das 7. Lebensjahr noch nicht vollendet haben (diese gelten gemäß § 104 BGB als geschäftsunfähig) und Minderjährigen, die das siebente Lebensjahr vollendet haben (diese sind nach Maßgabe der §§ 107 bis 113 BGB in der Geschäftsfähigkeit beschränkt).
Diese Beschränkungen in der Geschäftsfähigkeit machen den Warenhandel und Dienstleistungsvertragsschluss mit Kindern und Jugendlichen zu besonderen Rechtsgeschäften. Denn nach § 108 BGB gilt, dass die Wirksamkeit eines von einem Minderjährigen geschlossenen Vertrages von der Genehmigung seines gesetzlichen Vertreters abhängt.
Das bedeutet, dass ein Vertreter, zum Beispiel die erziehungsberechtigten Elternteile, einen Vertrag ausdrücklich im Nachhinein genehmigen müssen, damit dieser wirksam wird.
Dabei haben zwei sorgeberechtigte Elternteile streng genommen, beide gemeinschaftlich ihre Genehmigung zu erteilen (§§ 1626, 1629 Abs. 1 S. 2 BGB). Dasselbe gilt auch, wenn die Eltern im Namen des Kindes einen Vertrag schließen. Allerdings kann aus Gründen der Praktikabilität ein Elternteil den anderen bevollmächtigen, ein Rechtsgeschäft im Namen des Kindes allein zu schließen. Ohne die entsprechende Genehmigung kommt kein wirksamer Vertragsschluss zustande.
Alternativ kann natürlich bereits vor Vertragsschluss eine entsprechende Einwilligung des Vertreters des Minderjährigen erteilt werden. Dies bedingt natürlich unweigerlich, dass der gesetzliche Vertreter auch Kenntnis von den Vertragsgesprächen zwischen dem Verkäufer und dem Minderjährigen erlangt. Der § 131 Abs. 2 BGB stellt insoweit sicher, als die Willenserklärung, die gegenüber einem Minderjährigen abgegeben wird, nur dann wirksam wird, soweit sie dessen gesetzlichem Vertreter zugegangen ist.
Bedarf eine Schenkung die Zustimmung der Eltern?
Egal, ob Ihr Kind ein Geschenk von den Verwandten und Freunden oder ein Gratis-Würstchen an der Fleischtheke erhält, erfolgt dies meist ohne die Zustimmung der Eltern. Eine Schenkung stellt grundsätzlich ebenfalls einen Vertrag dar. Fraglich ist also, ob auch hier eine Zustimmung des gesetzlichen Vertreters erforderlich ist.
Eine Schenkung ist für Minderjährige in der Regel rechtlich vorteilhaft, da diese nicht mit Nachteilen, wie etwa die Zahlung eines Kaufpreises, verbunden ist. Insofern ist eine Einwilligung des gesetzlichen Vertreters nicht erforderlich. Etwas anderes kann jedoch gelten, wenn es sich beispielsweise um ein Geschenk mit erhöhtem Gefahrenpotential handelt.
Der Taschengeldparagraph
Da das vorstehende Vorgehen in der geschäftlichen Praxis äußerst unpraktikabel ist, sieht der Gesetzgeber in § 110 BGB vor, dass ein von einem beschränkt geschäftsfähigen Minderjährigen ohne Zustimmung des gesetzlichen Vertreters geschlossener Vertrag als wirksam gilt, wenn der Minderjährige die vertragsmäßige Leistung mit Mitteln bewirkt, die dem Minderjährigen zu diesem Zweck oder zu freier Verfügung von dem Vertreter oder mit dessen Zustimmung von einem Dritten überlassen worden sind.
Kurz gesagt bedeutet dieser sogenannte „Taschengeldparagraf“, dass Minderjährige ihr Taschengeld, welches ihnen regelmäßig zur freien Verfügung überlassen wird, uneingeschränkt nutzen und ausgeben können.
Doch auch hier muss der Vertragspartner aufpassen, dass nicht ein erkennbares Missverhältnis zwischen dem Taschengeld des Minderjährigen und dem Preis der vertraglichen Leistung besteht. So wird ein Minderjähriger in der Regel nicht mehrere hundert oder tausend Euro im Rahmen seines Taschengeldes ausgeben können, wenn aufgrund des Alters des Minderjährigen gerade einmal ein monatliches Taschengeld von etwa 20,00 Euro zu erwarten ist. Auch kann nur auf den Taschengeldparagrafen abgestellt werden, wenn der Minderjährige den Kaufpreis vollständig beglichen hat und es sich nicht um ein Abo oder eine Ratenzahlung handelt. In diesem Zusammenhang ist festzuhalten, dass Gesetzgeber und Rechtsprechung den Schutz des Minderjährigen dem Vertrauensschutz des Vertragspartners vorziehen.
In einem Fall vor dem Amtsgericht Düsseldorf hat ein Minderjähriger auf dem von den Eltern zur Verfügung gestellten Prepaid-Handy Klingeltöne in Höhe von 38 Euro heruntergeladen. Die Eltern waren mit dem Vertragsschluss nicht einverstanden und forderten die Rückzahlung von dem Anbieter. Der Anbieter bezog sich auf den Taschengeldparagrafen und war der Meinung, dass der Vertrag wirksam zustande gekommen ist, da die Eltern mit der Überlassung des Handys konkludent in einen Vertragsschluss eingewilligt hätten. Das Gericht hat allerdings entschieden, dass die Überlassung eines Prepaid-Handys normalerweise zum Zweck der Erreichbarkeit des Kindes dient, nicht jedoch zum Kauf von Klingeltönen (AG Düsseldorf, Urteil vom 02.08.2006, 52 C 17756/05). Insofern hat das Gericht den Vertrag als unwirksam erachtet und den Eltern einen Rückzahlungsanspruch gegen den Anbieter gewährt.
Grenzen des Minderjährigenschutzes
Unter Umständen kann es dennoch vorkommen, dass Sie als Eltern eine Ersatzpflicht trifft. Dies ist etwa dann der Fall, wenn der Minderjährige aufgrund bestimmter Faktoren die erforderliche Einsichtsfähigkeit besaß.
Bereits vor mehreren Jahrzehnten hat der BGH ein bedeutendes Urteil gefällt, in welchem ausnahmsweise eine Ersatzpflicht der Eltern angenommen wurde (BGH, Urteil vom 07.01.1971, VII ZR 9/70). In diesem Fall erwarb ein Jugendlicher kurz vor seinem 18. Lebensjahr ein Flugticket für die Strecke von München nach Hamburg ohne die Einwilligung seiner Eltern. In Hamburg angekommen, flog er als blinder Passagier ohne Flugticket nach New York, wo er aufgrund eines fehlenden Visums aufgeflogen ist. Die Fluggesellschaft flog den Jugendlichen am selben Tag nach München zurück und verlangte von den Eltern die Bezahlung der beiden Flüge.
Grundsätzlich hat der BGH jegliche Ansprüche aus dem Vertrag verneint, da ein Vertrag mangels beschränkter Geschäftsfähigkeit des Jugendlichen und fehlender Einwilligung der Eltern nicht wirksam zustande gekommen ist. Da der Jugendliche jedoch fast volljährig war und genau erkennen konnte, dass er im vorliegenden Fall eine unerlaubte Handlung bzw. Straftat begeht, hat das Gericht eine Ersatzpflicht der Eltern angenommen.
Wenn der Vertragspartner den Vertrag trotz nachträglicher Einwilligung der Eltern stornieren möchte
Erfährt der andere Vertragspartner von der Minderjährigkeit seines Vertragspartners und möchte sich nun trotz nachträglicher Einwilligung der Eltern von dem Vertrag lösen, so ist dies nicht ohne weiteres möglich.
Nehmen wir also einmal an, dass Ihr Kind ohne vorherige Einwilligung im Internet eine bestimmte Sache bestellt, Sie im Nachhinein jedoch mit der Bestellung einverstanden sind und den Vertrag auch gegenüber dem Vertragspartner Ihres Kindes genehmigen. Sobald Sie die Genehmigung erteilt haben, ist der Vertrag nicht mehr schwebend unwirksam und der Vertragspartner kann den Vertrag nicht mehr widerrufen.
Ein Widerruf ist nur bis zur Einwilligung der Erziehungsberechtigten möglich (§ 109 Abs. 1 BGB).
Etwas anderes gilt, wenn der Minderjährige dem Vertragspartner zuvor vorgegaukelt hat, dass die Eltern mit dem Vertragsschluss einverstanden seien (§ 109 Abs. 2 BGB). Ein Widerruf durch den Verkäufer ist ausgeschlossen, wenn dieser als Vertragspartner wusste, dass die Eltern des Minderjährigen nicht mit dem Vertragsschluss einverstanden sind.
Was gilt, wenn der Benutzeraccount auf den Namen der Eltern läuft oder die Zahlungsinformationen der Eltern unbefugt genutzt wurden?
In den meisten Fällen erhalten Kinder und Jugendliche über das Smartphone oder den Laptop der Eltern Zugang zu verschiedenen Apps und Onlinespielen oder das eigene Smartphone des Kindes läuft über den Namen eines Elternteils. Teilweise legen sich Kinder auch selbst ein Nutzerkonto an und benutzen unbefugt die Zahlungsinformationen der Eltern. Viele vermeintlich kostenlose Onlinespiele bieten sog. „In-Game-Käufe“ an, mit denen man mit realem Geld weitere Features hinzukaufen kann. Schnell entsteht ein Betrag über mehrere hundert Euro. Zu unterscheiden sind dabei folgende Konstellationen:
- Hat Ihr Kind selbst ein Benutzerkonto erstellt und verwendet Ihre Zahlungsinformationen (z.B. Kreditkarte, PayPal) ohne, dass Sie Kenntnis davon haben, so steht Ihnen ein Rückzahlungsanspruch zu. Der Vertrag ist aufgrund der Minderjährigkeit und fehlenden Einwilligung der Eltern schwebend unwirksam. Da der Taschengeldparagraf nicht auf Rechnungen anwendbar ist, greift auch dieser in der vorliegenden Konstellation nicht. Es empfiehlt sich, zunächst direkt mit dem Anbieter Kontakt aufzunehmen und diesen unter Schilderung des Sachverhalts um eine Stornierung und Rückzahlung zu bitten. Eine Stornierung über den Zahlungsanbieter (z. B. Chargeback über die Kreditkarte) sollte man sich zweimal überlegen, da dies sehr wahrscheinlich ungewünschte Folgen für das Vertragsverhältnis mit dem Anbieter haben wird!
- Zudem gibt es die Möglichkeit, In-Game-Käufe über das sogenannte „Pay by Call-Verfahren“ abzuwickeln. Die zahlungspflichtigen Features können damit über eine kostenpflichtige SMS oder mit einem Anruf einer 0900-Rufnummer bezahlt werden. Der angefallene Geldbetrag wird über die Telefonrechnung abgerechnet. So hat in einem Fall vor dem BGH ein 13-jähriger Junge In-Game-Käufe in Höhe von insgesamt 1.253,93 € getätigt, indem er über den Festnetzanschluss seiner Mutter die kostenpflichtige 0900-Rufnummer anrief. Seine Mutter wusste von den Telefonanrufen nichts und war mit einer Bezahlung über ihren Telefonanschluss auch nicht einverstanden. Der BGH hat entschieden, dass der Anschlussinhaber in Fällen, in denen ihm die Inanspruchnahme der Leistungen des Anbieters nicht zugerechnet werden kann, nicht haftet (BGH, Urteil vom 06.04.2017, III ZR 368/16). „Pay by Call“ oder „call2pay“ wird jedoch heute nur noch selten verwendet, zumal Servicenummern bei vielen Handyverträgen standardmäßig blockiert sind.
- Etwas schwieriger gestaltet sich die Situation, in der Sie als Elternteil selbst den Account angelegt haben. Zu unterscheiden ist in diesem Fall, ob Ihr Kind das Passwort kannte oder nicht. Kannte Ihr Kind das Passwort und hat die von Ihnen hinterlegten Zahlungsinformationen unbefugt genutzt, so geht man von einer sog. Anscheinsvollmacht aus. Der Online-Dienstleister hat gegen Sie dann tatsächlich einen Zahlungsanspruch, es sei denn, Sie können darlegen, dass Sie alles Erforderliche getan haben, um eine unbefugte Nutzung durch Ihr Kind zu verhindern. Etwas anderes gilt, wenn Ihr Kind das Passwort grundsätzlich nicht kannte, dieses aber gestohlen oder sich in den Account gehackt hat. In diesem Fall können Sie das Geld von dem Online-Anbieter zurückverlangen.
Was tun, wenn das Geld bereits abgebucht wurde?
Sollte der Vertragspartner den Geldbetrag bereits eingezogen haben, welcher ihm aufgrund der Unwirksamkeit des Vertrages gar nicht zusteht, haben Sie gegenüber diesem grundsätzlich einen uneingeschränkten Rückzahlungsanspruch. Sie könnten den bereits abgebuchten Geldbetrag also entweder zurückbuchen (falls technisch möglich und sinnvoll) oder den Vertragspartner schriftlich zur Rückzahlung auffordern. Sollte der Vertragspartner nicht auf die Forderung eingehen, sollten Sie sich mit einem Rechtsanwalt in Verbindung setzen. Kann keine außergerichtliche Einigung erzielt werden, ist eine gerichtliche Durchsetzung Ihrer Forderung ratsam.
Verletzung der Aufsichtspflicht
Nun stellen Sie sich sicherlich die Frage, ob Sie der Anbieter wegen der Verletzung der Aufsichtspflicht auf Schadensersatz verklagen kann. Dies ist in der Regel nicht so einfach. Der BGH hat dazu entschieden, dass es genügt, wenn Eltern ihre Kinder über die Gefahren, die mit der Internetnutzung verbunden sind, aufklären (BGH 15.11.2012, I ZR 74/12). Der Umfang der Belehrung orientiert sich grundsätzlich an dem Alter und der Einsichtsfähigkeit des Kindes. Stattdessen wird nicht erwartet, dass Eltern den Computer oder das Smartphone und die Internetnutzung des Kindes regelmäßig kontrollieren. Dies ist erst dann erforderlich, wenn konkrete Anhaltspunkte für einen Missbrauch vorliegen.
Um auf Nummer sicher zu gehen, gibt es für iOS und Android mehrere Tools, um unbeaufsichtigte Käufe durch Ihre Kinder zu verhindern. So können Sie bei verschiedenen Smartphones einen PIN-Code für In-App-Käufe festlegen, welcher vor jeder Transaktion abgefragt wird. Teilweise können In-App-Käufe auch vollständig deaktiviert oder die App-Nutzung eingeschränkt werden. Zudem können Sie bei verschiedenen Spielkonsolen spezielle Zugänge für Kinder und Jugendliche einrichten. In Bezug auf Ihre Mobilfunknummer können Sie eine sog. Drittanbietersperre einrichten lassen, sodass eine Abrechnung über die Handyrechnung nicht mehr möglich ist.
Worauf Verkäufer beim Vertragsschluss mit Kindern und Jugendlichen achten sollten
Neben den vorstehenden Einschränkungen muss ein Verkäufer auch beachten, dass es eine Vielzahl von Waren gibt, die aufgrund des Jugendschutzes überhaupt nicht an Kinder und/oder Jugendliche verkauft werden dürfen. So dürfen beispielsweise nach dem Jugendschutzgesetz (JuSchG) Branntwein, branntweinhaltige Getränke oder Lebensmittel, die Branntwein in nicht nur geringfügiger Menge enthalten, nicht an Minderjährige und andere alkoholische Getränke nicht an Minderjährige unter 16 Jahren verkauft werden. Vergleichbare Regelungen gibt es im Rahmen der Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK), die den Verkauf an Personen unter der jeweils vergebenden FSK-Eingruppierung untersagen.
Dementsprechend bleibt festzuhalten, dass sich Verkäufer – gerade wenn Sie Ihre Waren über das Internet anbieten – immer über das Alter des potenziellen Käufers in Kenntnis setzen sollten (oder gar vergewissern müssen, wenn Leistungen angeboten werden, bei denen der Gesetzgeber einen besonderen Schutz Minderjähriger vorsieht). Andernfalls besteht für den Verkäufer die Gefahr, dass ein vermeintlich geschlossener Vertrag nicht wirksam ist oder dass der Verkäufer sich wegen der Verletzung von Schutzvorschriften sogar strafbar macht.
Verkäufer sollten zudem in Erinnerung behalten, dass sie – sobald sie Kenntnis von einem Vertreter haben – diesen gemäß § 108 Abs. 2 BGB zur Erklärung über die Genehmigung auffordern können. Erfolgt sodann binnen zwei Wochen keine Erklärung des Vertreters, so gilt die Genehmigung als verweigert. Dies schafft Planungssicherheit für den Verkäufer.